|
Chóra-Kirche - Eisenkirche - Ökumenisches Patriarchat - Valens-Aquädukt |
Unsere heutige Route bildet ein Rechteck: von Laleli nach Topkapı, und weiter über Edirnekapı nach Fener, dann am Goldenen Horn entlang bis zur Atatürkbrücke, schließlich zurück nach Laleli.

Fast in jedem Reiseführer wird eine Besichtigung der Chóra-Kirche angepriesen, und genau das haben wir heute als erstes vor. Schon wieder eine Kirche? Was macht die Kirchenbesichtigungen so attraktiv? Einer der Hauptgründe für uns ist die Begegnung mit der Stadtgeschichte, die sich in diesen altehrwürdigen Gebäuden zeigt. Aber nicht nur das.
Auch andere Gebäude erzählen über die Vergangenheit, über die der Völker, die uns nicht so vertraut sind, die Völker Asiens, die über die Jahrhunderte Einfluss am Bosporus gewannen. Gerade die (ehemaligen) Kirchen Istanbuls jedoch, allen voran die Agia Sofía, geben Auskunft über einen wichtigen Teil europäischer Geschichte, über das gigantische Römische Reich und seine Spaltung, über seine Herrscher, seine Riten, seine Religion.
Über Jahrhunderte hinweg trotzten diese Kirchen den Witterungseinflüssen, Erdbeben, Feuer und Kriegen. Sie vermoderten, stürzten ein, verbrannten oder wurden umfunktioniert, doch immer wieder wurden sie aufgebaut und restauriert. Sie erhielten neue Bausubstanzen und Formen, blieben aber letztendlich als Symbol für die eigenen Lebensvorstellungen erhalten.
Unter osmanischer Führung wurden ob dieser Bedeutung fast alle christlichen Kirchen in Istanbul entweder geschlossen oder anderweitigen Funktionen zugeführt. Im modernen türkischen Staat nutzt man jedoch die touristische Attraktivität und hat aus vielen der früheren christlichen Kirchen Museen gemacht, die man restaurieren und dem Publikumsverkehr öffnen konnte.
So ist es auch der Chóra-Kirche ergangen, die nun Kariye-Müzesi heißt. Sie liegt im Stadtteil Edirnekapı, direkt an der berühmten Theodosianischen Landmauer, westlich von Fener, und ist mit der Straßenbahn von Laleli über Topkapı (Umsteigepunkt) ganz einfach zu erreichen.
Die Ausmaße der ehemaligen Stadtbegrenzung, die schon im 5. Jahrhundert unter Theodosius II errichtet wurde, um das erweiterte Stadtgebiet von Konstantinopel zu schützen, werden auf der Fahrt durch die heute anrainenden Stadtteile deutlich. Das einstige Bollwerk ist in Teilen zerstört, in anderen jedoch sehr gut erhalten bzw. restauriert.
Aufgrund der Konstruktion (einem bis zu 20 Meter breiten und über 5 Meter tiefen Wassergraben, einer ca. 2 Meter hohen Grabenmauer, einer sich anschließenden bis zu 8 Meter hohen Vor- und der bis zu 12 Meter hohen Hauptmauer sowie 96 wuchtigen Türmen) war es für Angreifer sehr schwer, diesen Wall zu durchbrechen. Er galt als unüberwindbar. Auch den Angriffen der Osmanen hielt er mehrere Wochen stand.

Ob es in Topkapı, in Edirnekapı oder an anderen Stellen, vielleicht sogar gleichzeitig geschah, Konstantinopel fiel letztendlich durch die Überwindung dieses Verteidigungswerkes am 29. Mai 1453 an die Osmanen.

„Kapı“ bedeutet „Tor“. In Edirnekapı (Adrianopel-Tor) gelangt man von der Straßenbahnhaltestelle durch dieses Tor in der teilweise restaurierten Mauer in den gleichnamigen Stadtteil. Dahinter empfängt uns ein Standbild von Mehmed II, dem der Sieg einst gelang.

Ganz in der Nähe befinden sich die Ruinen des Blachernenpalastes, ab dem 13. Jahrhundert kaiserliche Residenz, zwischen der Chora-Kirche, dem Adrianopel-Tor und dem Goldenen Horn gelegen.
Wir jedoch passieren das Standbild Mehmeds, halten uns schräg nach links, leicht bergab und gelangen in eine Gasse, die von bemerkenswert bunt angestrichenen Holzhäusern gesäumt ist. Ihren Erhalt könnten sie einem Mann verdanken, der auf seiner Gedenkseite mit "Rechtsanwalt, Manager, Autor" bezeichnet wird. Es handelt sich um Çelik Gülersoy, der sich sehr um den Denkmalschutz in Istanbul verdient gemacht hat.
In den 60er Jahren wurde er Geschäftsführer des TTOK (Türkischer Touring- und Automobilclub). In dieser Position und als gewähltes Mitglied der „Internationalen wissenschaftlichen Tourismusexpertenvereinigung" brachte er viele Ideen für den Ausbau des Tourismus in Istanbul ein. Einen Namen machte er sich auch mit eigenen Publikationen, wie der preisgekrönten „Geschichte des überdachten Basars". Ab 1979 widmete er sich dem praktischen Erhalt von historischen Gebäuden. Er ließ Pavillions restaurieren, aber auch historische Straßenzüge, unter anderem in Sultanahmed. Auch alte Holzhäuser in Edirnekapı wurden unter seiner Federführung in Stand gesetzt. Für sein großes Engagement erhielt er zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen.

Am Ende der Gasse wenden wir uns nach links und sehen vor uns die breite Vorderseite der Chóra-Kirche.

Der griechische Name bedeutet in diesem Zusammenhang soviel wie „Land“ und trug dem Umstand Rechnung, dass zu Zeiten der Erbauung der Chóra-Kirche im 5. Jahrhundert (noch außerhalb der damaligen Stadtmauer Konstantinopels) es hier nichts anderes als ländliche Flächen ohne sonstige Bebauung gab. Auch der türkische Name „Kariye“ bedeutet dasselbe.
Das Gebäude erlebte Erdbeben und Einstürze, doch die heutige Form der Chóra-Kirche besteht schon seit dem 14. Jahrhundert. Es war Theodoros Metochites, Kanzler und erster Schatzmeister zu jener Zeit, der die Kirche renovieren und mit Bildern und Mosaiken von herausragender Qualität ausstatten ließ.

Nach der Eroberung der Stadt durch die Osmanen teilte die Chóra-Kirche zwar dasselbe Schicksal mit vielen anderen christlichen Kirchen Konstantinopels und wurde zur Moschee; die zahlreichen Kunstschätze in Form von Mosaiken und Fresken wurden unter Putz gelegt oder übermalt, konnten jedoch später größtenteils gerettet werden und bilden heute die Hauptattraktion des Kirchen-Museums. Schon im späten 19. Jahrhundert nannte man es die „Mosaik-Moschee“.
Verdient gemacht haben sich darum Thomas Whittemore und Paul A. Underwood, die die vom „Byzantinischen Institut von Amerika" und „Dumbarton Oaks Center für byzantinische Studien" finanzierte Restaurierung organisierten. In den Jahren 1945 bis 1958 wurden in mühevoller Kleinstarbeit die verbliebenen Kunstwerke von Putz und Farbe befreit, kleinere Ausgrabungen vorgenommen und das Gebäude insgesamt restauriert.
Durch ein Außentor betreten wir das Außengelände, entrichten den Eintritt von 15 TL (ca. 8 Euro) pro Person und umrunden zunächst den byzantinischen Gebäudekomplex, bestaunen seine äußere Form mit den steinernen Streben und statischen Elementen.


Im Innenraum erwarten uns die wahren Schätze, Mosaiken und Fresken, von denen man lesen kann, dass sie die schönsten in ganz Istanbul sind. Entsprechend begehrt ist ihre Besichtigung bei Touristen aus aller Welt.
Dem Kircheninnern, dem Naós, sind wie häufig in orthodoxen Kirchen, zwei Vorräume vorgebaut: der innere (Esonarthex) und der äußere Vorraum (Exonarthex). Durch den Haupteingang betreten wir den Exonarthex, wo insbesondere Darstellungen der Kindheitsgeschichte Jesu wiedergegeben werden.
Der Esonarthex wird beherrscht von den beiden Kuppeln mit der Darstellung von Jesus mit den alttestamentarischen Vorfahren (südliche Kuppel) und von Maria mit Kind, umgeben von 16 Figuren (nördliche Kuppel).


An den Wänden und der Decke des Esonarthex befinden sich Mosaike mit den Ausschmückungen von Jesu' Wirken als Erwachsener sowie die Mariengeschichte. In den bildhaften Darstellungen erkennen wir die Liebe zum Detail. Einige der Kunstschätze sind leider ganz oder teilweise zerstört.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Am südlichen Ende des Exonarthex biegt man ab in das Parekklesion (Seitenkapelle, auch Grabkapelle), das den Themen „Auferstehung" und „Jüngstes Gericht" gewidmet ist, und dessen Apsis ein gewaltiges Fresko enthält. Christus in der Mitte zieht Adam und Eva aus ihren Gräbern, andere bedeutende Heiligenfiguren stehen rechts und links im Bild. Eine reich geschmückte und gut erhaltene Kuppel zeigt eine weitere Mariendarstellung.



Wir gehen zurück, wieder zum Haupteingang, um nun den Kircheninnenraum (Naós) zu besichtigen. Der Durchlass wird flankiert von zwei Mosaiken: Petrus mit einem Schlüssel und Paulus mit einem Buch.


Ausschmückungen im Kircheninnenraum gibt es nur sehr wenige. Fast alle Wände wurden mit Marmorplatten versiegelt, die Decke ist ebenfalls ohne Darstellungen. Es gibt keine Altarwand, und der ehemalige Altarraum besteht aus den nackten Wänden. An den Pfeilern, die die Kuppel tragen, sind noch zwei Darstellungen in einem relativ schlechten Zustand erhalten: rechts Maria mit Jesus auf ihrem Arm, links Jesus mit einem offenen Buch. Das auffälligste Relikt in diesem Raum ist ein reich bebildertes Mosaik mit der Darstellung von der Entschlafung Mariens.

Langsam schlendern wir nochmals durch die Räumlichkeiten und bewundern die herausragenden, bildlichen Darstellungen, wie die Folgende: Jesus mit Maria; zu ihren Füßen kniend Isaak Komnenos, der die Kirche im 12. Jahrhundert erneuern ließ; rechts unten Maria Palaiologina.

Selbst in den Wölbungen der Decken sind kleine Geschichten aus der Bibel in Mosaikform wiedergegeben.


Am Ende bewundern wir das große, ausdrucksstarke Mosaik des Christus Pantokrator direkt über dem Durchgang vom Exo- in den Esonarthex, am Haupteingang. Auf einer Inschrift steht: „Jesus Christus, Land der Lebenden".

Zum Ausgang hin passieren wir einen Museumsshop, in dem man das Übliche erstehen kann.

Wieder draußen, vor der Kirche, brauchen wir nach der ca. zweistündigen Besichtigung zunächst eine Pause, um das Gesehene ein wenig zu verarbeiten. Auch wenn wir während unseres Aufenthaltes in Istanbul schon viele verschiedene Eindrücke sammeln konnten, stellt der Besuch des Kariye-Museums ein absolutes Highlight dar, das man sich als Besucher der Stadt nicht entgehen lassen sollte.
Geöffnet ist es lt. Faltblatt ab 9.00 Uhr morgens bis 16.30 Uhr im Winter bzw. 18.00 Uhr im Sommer, mittwochs geschlossen (Stand 2012).
Gegenüber dem Haupteingang der Chóra-Kirche befindet sich ein größeres Lokal mit Sitzgelegenheiten im Außenbereich, wo man sich gut auf die nächste Etappe des heutigen Tages einstimmen kann.
 Angeregt durch Fotos und Videos im Internet möchten wir in östlicher Richtung durch den Stadtteil Balat nach Fener schlendern. Früher waren diese Stadtteile kulturelle Zentren, in Balat von jüdischen und armenischen, in Fener hauptsächlich von griechischen Einwohnern, was insbesondere auf die Lage des Ökumenischen Patriarchats in Fener zurückzuführen ist. Die Bewohner nannte man denn auch Phanarioten (das griechische Äquivalent zum türkischen „Fener“ heißt „Fanari“ und bedeutet hier „Leuchtturm“). Adelige griechische Familien begannen im 18. Jahrhundert um das Patriarchat herum Villen zu errichten. Sie waren in der Regel wohlhabend und gebildet, bekleideten Diplomaten- oder Regierungsposten mit hohen Positionen. Doch schon im 19. Jahrhundert zogen sie an die Ufer des Bosporus. Zurück blieben kleine Händler und Künstler. Nach dem Pogrom 1955 und dem daraus resultierenden Exodus der Griechen aus Istanbul änderte sich die Bevölkerungsstruktur von Grund auf.
Angeregt durch Fotos und Videos im Internet möchten wir in östlicher Richtung durch den Stadtteil Balat nach Fener schlendern. Früher waren diese Stadtteile kulturelle Zentren, in Balat von jüdischen und armenischen, in Fener hauptsächlich von griechischen Einwohnern, was insbesondere auf die Lage des Ökumenischen Patriarchats in Fener zurückzuführen ist. Die Bewohner nannte man denn auch Phanarioten (das griechische Äquivalent zum türkischen „Fener“ heißt „Fanari“ und bedeutet hier „Leuchtturm“). Adelige griechische Familien begannen im 18. Jahrhundert um das Patriarchat herum Villen zu errichten. Sie waren in der Regel wohlhabend und gebildet, bekleideten Diplomaten- oder Regierungsposten mit hohen Positionen. Doch schon im 19. Jahrhundert zogen sie an die Ufer des Bosporus. Zurück blieben kleine Händler und Künstler. Nach dem Pogrom 1955 und dem daraus resultierenden Exodus der Griechen aus Istanbul änderte sich die Bevölkerungsstruktur von Grund auf.Balat mit seiner hauptsächlich jüdischen Einwohnerschaft hingegen entvölkerte sich aufgrund von Erdbeben und Feuer; Ende des 19. Jahrhunderts zog man nach Galata, auf die andere Seite des Goldenen Horns, wo es auch heute noch jüdische Zentren und Synagogen gibt. Ein Viertel der ehemaligen Bewohner Balats jedoch emigrierte nach Israel.
Heute beherbergen beide Stadtteile größtenteils Zuwanderer aus Anatolien, die aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage billigen Wohnraum suchten und ihn in den halb verfallenen Häusern fanden.

Zur Sanierung wurden in den letzten Jahren in beide Distrikte erhebliche Geldsummen gesteckt, die zum Teil auch aus Mitteln der EU stammen (7 Millionen Euro). Dadurch wurden die Stadtteile nicht nur aufgewertet (und wohl auch der Wohnraum verteuert), auch historische Bauten konnten erhalten werden, denn mehr als die Hälfte der Gebäude, die dieser Region ihre eigene Atmosphäre geben, datiert von vor 1930.
Durch schmale und am heutigen Sonntag recht leere Sträßchen führt unser Weg von der Chóra-Kirche aus zunächst ein wenig bergab. Schon bald sehen wir, dass einige der Gassen wieder hügelan nach oben abzweigen.


Es ist sicherlich interessant, durch die Wohngegend zu spazieren und von dort oben auf das Goldene Horn und die Umgebung zu blicken, doch wir sparen uns die Aussicht, folgen dem bisherigen Weg und gelangen schließlich in eine belebtere Gegend.


Auf dem Schild steht: „Volksbrot - Akbil-Aufladung - Lebensmittel"
(Akbil ist ein Chip für den Nahverkehr)
Die Vodina-Straße, zwischen Balat und Fener, erhielt ihren Namen von der gleichnamigen makedonischen Stadt. Auf einem kleinen Schild werden wir zudem auf zwei Kirchen aufmerksam, eine davon in unmittelbarer Nähe, die andere in Sichtweite auf einem Hügel, neben dem imposanten Bau eines Gymnasiums.
Entlang einer Seite der Vodina-Straße zieht sich eine hohe Mauer, die das Areal der Agios-Giórgos-Kirche vor neugierigen Blicken und unbefugten Zutritten schützt.

Als wir eine schmale Tür in der Begrenzung passieren, öffnet sie sich und entlässt wenige Leute. Wir fragen, ob wir eintreten dürfen. Das wird uns gestattet, doch das Fotografieren nicht. Dösende Hunde liegen auf dem Gelände. Der Wärter bittet uns in den Kirchenvorraum, wo wir auf einer Mauer, auf Sitzkissen, Platz nehmen können. An einer Wand hängen Bilder verschiedener Patriarchen, in der Mitte das des amtierenden, Bartholomäus.
Bereitwillig erzählt der Wärter über die Geschichte der Kirche, aber auch von der heutigen Situation in diesem von Moslems bewohnten Stadtteil. Viele der Bewohner seien arm, man befürchte Einbrüche. Daher sei das Kirchengebäude durch dicke Eisenketten fest verschlossen und jederzeit gut bewacht. Nur einmal im Jahr, zum Fest des Heiligen Georg, würde es geöffnet, dann läse der Ökumenische Patriarch persönlich hier die Messe. Wir hätten Glück, dass der Wärter heute überhaupt da sei, meint er. Doch jetzt, während der Karwoche, sei er täglich anwesend.
Er zeigt uns auch die große Platane auf dem Gelände, die schon viele hundert Jahre alt sein soll – Byzantiner, Römer, Griechen und Osmanen habe sie erlebt. Langsam verabschieden wir uns von dem freundlichen Menschen, der hier die Stellung hält, während wir weiter ziehen.
Nur wenige Meter unterhalb erreichen wir einen großen Park am Ufer des Goldenen Horns. Sehr lebendig geht es in diesem Naherholungsgelände mit den schön angelegten Blumenbeeten zu. Die Menschen erfreuen sich des Lebens und wohl auch des schönen Frühlingswetters am heutigen Tag. Auf den Rasenflächen wird gegrillt, Kinder toben herum; die Freizeitmöglichkeit der einfachen Leute.

Quer durch den Park, gleich an der Straße gelegen, die parallel zum Goldenen Horn verläuft, leuchtet ein vergoldeter Turm herüber.

Er gehört zur bulgarischen St.-Stephans-Kirche mit der Besonderheit ihres Baumaterials: Beton wurde wegen des Untergrundes (Überschwemmungsgebiet des Goldenen Horns) aufgrund seiner Schwere kaum verwendet, die Konstruktion besteht fast zur Gänze aus Stahl und Eisen. Und so wird sie auch genannt: die Bulgarische Eisenkirche, entworfen von Hovsep Aznavur, einem Istanbuler Architekten armenischer Herkunft, konstruiert von der Rudolf Phillip Waagner Gesellschaft, einem österreichischen Traditionsunternehmen. Die Einzelteile der Konstruktion wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Wien gegossen und über die Donau und das Schwarze Meer nach Istanbul verschifft. Durch ihre besondere Bauweise steht das Gebäude in einer Reihe von „Experimenten“ mit anderen Kirchen, die unter anderem vom Konstrukteur des Eiffelturms und auch von anderen Architekten beispielsweise in Litauen, den Philippinen, Australien, Chile, Mexiko und Costa Rica errichtet wurden.
Kein Feuer konnte der St-Stephans-Kirche etwas anhaben und auch kein Erdbeben. Doch der Zahn der Zeit in Form von Korrosion hatte nach 100 Jahren derart an ihr genagt, dass sie einer Komplettrestaurierung unterzogen werden musste. Neben dem Ansatz von Rost hatten sich breite Risse in der Außenhaut und den Pfeilern gebildet, die die Bausubstanz erheblich gefährdeten.

2,5 Millionen türkische Lira (über eine Million Euro) soll die Sanierung kosten. Gerne hätten wir uns die Kirche von innen angeschaut, doch alles ist verschlossen und zum Teil mit Planen verhangen bzw. eingerüstet. Aus der Entfernung sind noch Rostspuren zu erkennen, der Turm scheint aber bereits fertig zu sein.


Um die Ecke, an einer kleinen Kreuzung, finden wir ein winziges, urgemütliches Eck-Café mit vier Tischchen, wo man Kuchen und Tee bekommt und ein weiteres Päuschen einlegen kann. Wir sind nun schon seit eitlichen Stunden unterwegs, es ist bereits später Nachmittag.
|
Einheimische Männer spielen an einem der Tische Távli.Schräg gegenüber beschaut sich ein Junge von seiner Position auf einem Stromkasten die Café-Besucher. In einer Gruppe mit mehreren Jugendlichen, die das Lokal passiert haben, kommt es fast zur Schlägerei, als einer dem anderen eine klatscht. Doch weiter passiert zum Glück nichts, die jungen Leute ziehen weiter. Von rechts kommt ein Mann mit einer Karre, auf der er Altwaren sammelt; unablässig wiederholt er seinen Ruf. Links steht ein Fahrer vor seinem gelben Taxi, wittert ein Geschäft bei den Café-Besuchern. Ein weiterer Händler bietet Leckereien an, ein Blech voller Simit auf dem Kopf balancierend. |
 |
Einige der Häuser in den von unserer Position aus einsehbaren Straßen sind renoviert, doch die meisten bedürfen einer dringenden Erneuerung. Alles in allem scheinen wir uns in einem eher ärmlichen Viertel des ehemals wohlhabenden Phanar zu befinden.



Nach einer kleinen Rast möchten wir uns die Gebäude des Ökumenischen Patriarchats ansehen, falls das überhaupt möglich ist. Es ist nicht weit, nur ein paar hundert Meter weiter südlich, entlang der breiten Uferstraße des Goldenen Horns. Wieder entdecken wir ein dezent angebrachtes Kreuz, das uns den Weg in eine Parallelstraße zeigt. Rechterhand erhebt sich hinter der hohen Außenmauer, die das Gelände umgibt, die Spitze des Portals der Agios-Giórgos-Kirche.

Das weltberühmte Zeichen des Schisma, der doppelköpfige Adler, prangt über dem Haupteingang: ein Adler blickt nach links (Westrom), der andere nach rechts (Ostrom = Byzanz).


Darüber, unter dem Dachgiebel, ein in die Außenmauer gemeißeltes, schlichtes Kreuz, flankiert von ebenfalls eingravierten Inschriften.

|
Εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον Θεόν Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott |
Εν αρχή εποίησεν ο Θεός Ουρανόν και την Γην Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde |
Schlicht gestaltet sich auch der Vorraum der Kirche.


Im Innenraum der dreischiffigen Basilika, die seit 1601 zum Patriarchat gehört, singen einige Geistliche eine Liturgie. Niemand lässt sich von den Videoaufnahmen und Blitzlichtern der wenigen Touristen stören.

Zwischendurch erteilt in weiterer Geistlicher den Segen. Er geht mit einem Weihrauchgefäß durch die Kirche und schwenkt dieses auf und ab. Personen und Ikonen werden gleichermaßen in den duftenden Rauch gehüllt. Eine feierliche und erwartungsvolle Stimmung macht sich breit. Es ist Palmsonntag, heute beginnt die Megháli Evdhomáda, die Karwoche.
Als die Liturgie endet, gehen wir wieder nach draußen. Im Hof werden Eingang und Fenster eines schmalen Seitenanbaus mit Palmzweigen geschmückt und eine Ikone, die im Hof davorsteht, mit Blüten umrankt.

Die Ikone richtet sich an die Verzweifelten und soll ihnen Hoffnung geben. Bis Gründonnerstag (für die Orthodoxen der „Rote Donnerstag", also der Donnerstag vor Ostern) bleibt sie stehen. Bis dahin werden neben ihr jeden Tag Messen gelesen, Wünsche geäußert, von Gläubigen gebetet; man dankt für erfüllte Wünsche und Gutes im Leben.
Der Seitenanbau ist geöffnet. Er beinhaltet mehrere blankgeputzte, große Kupferkessel. Wir erfahren, dass in diesem Jahr, nach einer Dekade, wieder das Aghion Mýron hergestellt wird.
Damit bezeichnet man einen Extrakt, der aus Ölen und vielen verschiedenen Kräutern und Blüten zubereitet und in der Orthodoxen Kirche vorwiegend direkt nach der Taufe verwendet wird. Um dem Täufling geistige Stärke mit auf seinen Weg zu geben, werden seine Stirn, Augen, Ohren, Nase, Mund, Brust, Handgelenke und Fußrücken damit gesalbt.
Auch Kirchen werden mit diesem Öl geweiht. Mýron hat übrigens nichts mit Myrrhe (einem Harz) zu tun, sondern bedeutet Salbungsöl. Im Ökumenischen Patriarchat gibt es ein Register, in dem die verschiedenen aromatischen Stoffe definiert sind. Es sind 75 an der Zahl. Die ältesten, noch existenten Verweise darauf datieren aus dem 8. Jahrhundert.
Die Herstellung dieses Öls geschieht immer in der Karwoche. Zuvor wird die Synode vom Ökumenischen Patriarchen darüber informiert, aus der dann geistliche Würdenträger bestimmt werden, die während die Zeremonie bestimmte Aufgaben erfüllen. Der Ablauf ist stets der gleiche. An jedem Tag, von Palmsonntag bis Gründonnerstag, finden während der Liturgien verschiedene Handlungen statt.
Am Palmsonntag beginnt die Zeremonie mit der Segnung des leitenden Parfümeurs und seiner Assistenten. Sie sind verantwortlich für die Zusammenstellung der Inhaltsstoffe des Mýrons (Öle und Kräuter) in einer bestimmten Konsistenz.
Montags werden der Raum mit den Kesseln und die Utensilien gesegnet. Dann zündet der Ökumenische Patriarch mit einer brennenden Kerze das Anzündholz unter den Kesseln an.
Dienstags werden in einer Messe diejenigen gewürdigt, die mit Material, Geldspenden und ihrer Arbeitskraft ihren Beitrag zur Vorbereitung der Zeremonie geleistet haben.
Mittwochs werden Rosenöl, Moschus und andere duftende, fein abgestimmte Ingredienzien in die Kessel gegossen. Am Ende dieses Tages sind die Vorbereitungen abgeschlossen.
Der Donnerstag ist der große Tag des Aghion Mýron. Das fertige Salbungsöl wird in Phiolen und andere Gefäße gegossen, die im Rahmen einer feierlichen Zeremonie gesegnet werden. Dieses Öl wird dann von den anwesenden Bischöfen und anderen hohen Würdenträgern (denn nur diesen ist die Herstellung erlaubt) in ihre Bistümer mitgenommen und an die einzelnen Kirchen verteilt.
Als wir am Palmsonntag den Anbau mit den Kesseln betreten, wissen wir von all dem nichts. Ein Geistlicher vom Aghion Oron erklärt Alex schließlich die Prozedur und schenkt ihm ein Heft, in dem der gesamte Ablauf auf Griechisch nachzulesen ist.
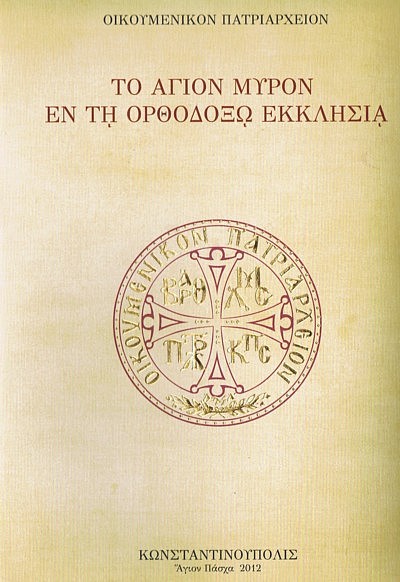
Nach einer Weile setzen wir uns wieder auf ein Mäuerchen im Hof. Security befindet sich überall, weltlich gekleidete Herren in dunklen Anzügen und mit aufmerksamen Blicken. Kein Wunder, denn plötzlich erscheint der Ökumenische Patriarch, Bartholomäus I, im schwarzen Ornat, in einer langen Reihe schwarz gewandeter Geistlicher, mit denen er zügigen Schrittes durch das Mittelportal die Kirche betritt.
Gut gekleidete Griechen bewegen sich hinter ihm ins Mittelschiff und bleiben stehen, während eine weitere, längere Liturgie angestimmt wird. Der kleine Chor von vorher steht in Blickrichtung nun links, ein Kantor mit zwei Begleitern intoniert von rechts mit kräftigem Bariton, schwingt im Körper mit, während er schwierige Passagen meistert.
Wir haben hinter dem linken Seitengestühl einen guten Blickwinkel gefunden. Dort hängt eine bemerkenswerte Ikone. Das Gemälde der Panaghía Faneroméni, das sich unter der Silberplatte befindet, ist sehr alt; man nimmt an, dass es noch vor dem 14. Jahrhundert gemalt wurde.

Weitere wertvolle Kunstschätze in dieser Kirche befinden sich in der Nähe der vergoldeten Altarwand, so ein Kerzenständer und die beiden Pulte für die Sänger. Riesige Lüster erhellen den Innenraum. Sitze und der Läufer in der Mitte des Innenraums sind leuchtend rot.

Gegenüber unseres Platzes, auf der anderen Seite des Innenraums, steht der patriarchale Thron, ein Kunstwerk, das aus Walnussholz gefertigt wurde und mit Perlmut, Elfenbein und farbigem Holz verziert ist.
Der Ökumenische Patriarch sitzt heute nicht auf diesem Thron, sondern daneben, aber auch auf einem erhöhten Sitz. Diese Position verrät die höhere Stellung, doch die schwarze Robe erscheint zumindest für uns als Außenstehende wie die der anderen Würdenträger: einfach und schlicht. In dieser Schlichtheit strahlt der Patriarch eine große Würde aus.

Direkt neben ihm steht sein Adlatus mit Blick in Richtung Ausgang. Er hält ihm das Gebetbuch, schlägt die jeweiligen Seiten auf, und nimmt mit ruhigem Blick jede Regung des Patriarchen wahr, stets bereit, das Ornat zu richten oder eine andere Handreichung zu erledigen.
|
Der Ökumenische Patriarch stammt von der ehemals griechischen, seit 1923 türkischen Insel Imbros/Gökçeada, die vor der nordtürkischen Ägäisküste liegt. Das Amt des Patriarchen bekleidet er seit 1991. Als „Erster unter Gleichen” ist er das geistliche Oberhaupt von etwa 300 Millionen orthodoxen Christen weltweit.
Neben seinen Aufgaben innerhalb der orthodoxen Kirche setzt er sich sehr für die Verständigung der Kirchen untereinander und für den Umweltschutz ein, was ihm den Titel „Grüner Patriarch“ eingebracht hat. |
Aus dem Allerheiligsten, hinter der Altarwand, tritt ein Priester in einem goldenen Gewand hervor, um seine Aufgaben während der Messe wahrzunehmen. Hin und wieder ergreift auch Bartholomäus das Wort, singt oder spricht mit klarer, fester Stimme.
Wieder werden alle Anwesenden und die Ikonen mehrfach gesegnet, beim Durchgang bleibt der Geistliche mit dem rauchenden Weihrauchgefäß direkt vor uns stehen, betet laut, während er das Gefäß mit metallenem Scheppern kräftig schwenkt, geht dann den Seitengang zurück, um wieder ins Mittelschiff zu gelangen. Zwei jüngere Geistliche ohne Kopfbedeckung fallen vor dem Patriarchen auf die Knie, danach treten sie einer nach dem anderen vor, um ihm die Hand zu küssen. Dann fallen sie nochmals auf die Knie und verlassen schließlich den Innenraum.
Weitere Geistliche treten vor den Patriarchen. Schließlich erheben sich alle, auch der Patriarch, bilden eine Reihe und verlassen schnellen Schrittes das Mittelschiff. Nach kurzer Zeit kehren sie zurück und nehmen wieder Platz.
 |
 |
 |
 |
Als wir die Kirche verlassen, ist die Messe noch nicht zu Ende. Wir sitzen noch ein wenig im Hof, lauschen den auf- und abschwellenden Gesängen, bewundern die beleuchtete Kirche, während die Nacht hereinbricht.

In einer Reihe verlassen alle Geistlichen am Ende wieder das Kirchengelände. Kurz darauf treten auch wir wieder auf die Straße. Da fährt ein Konsulats-Fahrzeug mit CC-Kennzeichen vor, um Passagiere aufzunehmen.
Langsam schlendern wir am Westufer des Goldenen Horns entlang in Richtung Atatürk-Brücke, die den Wasserlauf weiter südlich überquert. Wir genießen die warme Luft und sinnieren ein wenig über das gerade Erlebte. Die Besichtigung der Kirche und die Anwesenheit des Ökumenischen Patriarchen während der Liturgie, eingebettet in die Besonderheit der Vorbereitungszeit des Aghion Mýron während der Osterwoche, waren für uns etwas ganz Besonderes, an das wir uns auch später immer wieder erinnern.
An diesem lauen Frühlingsabend sitzen immer noch zahlreiche Menschen draußen im Park, grillen, klönen, lachen. Am Ufer festgezurrt dümpeln Schiffe dahin, Ausflugsboote in der Mehrheit. Auf einem wird ebenfalls im munteren Kreis gegrillt. Daneben ein winziges Fischerboot, von innen in ein futuristisches, lindgrünes Licht getaucht. Türkpop schallt heraus.
Auf einem kleinen Rasenstück spielt eine Familie im Halbdunkel Fußball, d.h. sie stehen im Kreis und schieben sich den Ball zu: Vater, Kinder und die Mutter, die laut lachend volle Granate gegen den Ball kickt und für den Schuss viel johlenden Beifall erhält.
Bald erreichen wir die Atatürkbrücke. Im 90-Grad-Winkel nach rechts folgenden wir dem gleichnamigen Boulevard. Unser Ziel ist die Hotelgegend in Laleli, wo wir in einem Restaurant zu Abend essen möchten. So weit kann das nicht sein, deshalb verzichten wir auf öffentliche Verkehrsmittel.
Die breite Avenue ist reichlich befahren; der Verkehr rauscht an uns vorbei, doch am heutigen Sonntag ist er im Vergleich zur Arbeitswoche eher noch sparsam.
An einem kniffligen Straßenübergang (Fußgänger sind auf sich selbst gestellt, man muss gut schauen, entschlusskräftig und schnell sein), überholt uns ein Mann, der einen schweren Karren hinter sich herzieht. Einer von vielen, die tagtäglich körperlich sehr hart arbeiten, um über die Runden zu kommen.
Ansonsten sind jede Menge Partygänger in Richtung Altstadt unterwegs, junge Leute, zu Fuß, meist aber mit einem der zahlreichen, vollgestopften Busse.
Schließlich unterqueren wir das hell beleuchtete, fast einen Kilometer lange Valens-Aquädukt, einen imposanten Bau aus konstantinischer Zeit, der früher wichtiger Teil der Istanbuler Wasserversorgung war. Unter anderem wurde mit dem Wasser, das über die steinerne Leitung transportiert wurde, auch die berühmte Yerebatan-Zisterne in der Altstadt gespeist.


Auf dem Stadtplan erkennen wir, dass wir schon ganz in der Nähe unseres Hotels sind, biegen rechtzeitig ab und erreichen eine der kleinen Gassen in Laleli mit ein paar Lokalen. Wir entscheiden uns mal wieder für ein Fischrestaurant. Kaum haben wir im ersten Stock am letzten freien Tisch Platz genommen, als ein Hagelschauer herniedergeht; die Hagelkörner in der Größe von Pferdebohnen prasseln ohrenbetäubend laut auf das Metalldach. Doch wir sitzen im Trockenen, und lassen uns verschiedene Fischsorten schmecken. So klingt ein weiterer ereignisreicher Tag aus, an dem wir neben den Besichtigungen auch ein klein wenig miterleben durften, wie die Menschen ihren Sonntag verleben, wie sie sich entspannen und lachen und sich ihren Familien widmen.
