| Omalós |
Nachdem wir uns am Vortag ausgeruht haben, steht für heute ein Ausflug nach Omalós an, mitten hinein ins Herz der Weißen Berge. Omalós, eine der drei großen Hochebenen Kretas, neben der Nída im Ida-Gebirge und der Lassíthi im Osten, Widerstandszentrum während der Aufstände gegen die türkische Besatzung, als es nur Eselspfade gab, über die man das auf über 1000 Meter hoch gelegene Plateau erreichen konnte, Startpunkt für eine Wanderung durch die berühmte Samariá-Schlucht oder hinauf auf den Gíngilos, den silbern glitzernden Fels hier am Ende der Schlucht, zum Besuch der Kallergie-Hütte und darüber hinaus, oder einfach Ausflugsziel, um die hohen, weiß-leuchtenden Bergspitzen der Lefká Ori aus der Nähe zu bestaunen und die Atmosphäre dort oben, die Abgeschiedenheit, Ruhe und Stille zu erleben.
Am späten Morgen sind wir startklar. Wir folgen zunächst der langgezogenen Dorfstraße in Kalýves, die uns nicht direkt zur Schnellstraße bringt, sondern in ihrer Fortsetzung als Landstraße (Old Road) automatisch die kurze Strecke hinauf auf den Kalámi-Hügel. Rechts schweift der Blick über die Soúda-Bucht mit ihrer makellosen, tiefblauen Farbe, während wir linkerhand die Festung Itzedin umrunden, die noch zu Zeiten der türkischen Besatzung, Mitte des 19. Jahrhunderts, errichtet wurde. Bis in die 1970er Jahre hinein wurde sie später als griechisches Gefängnis genutzt. Für uns als flüchtige Passanten hinterlässt sie einen militärischen Eindruck, wie eine Trutzburg, abgeschottet, gesichert, auf jeden Fall kein Gelände, das uns zu einer näheren Besichtigung einlädt.
Am höchsten Punkt des Kalámi-Hügels stehen wir unerwartet vor einer Auffahrt auf die Schnellstraße (New Road). Die wenigen Kilometer bis Chaniá sind schnell zurückgelegt, und irgendwie finden wir auch die richtige Ausfahrt, die uns zur Straße nach Fournés bringt. Der Abzweig nach Omalós mitten im Ort ist ausgeschildert.
Während wir bis hierher durch weitflächiges Orangenland gefahren sind, wird die Vegetation nun etwas karger. Olivenbäume und später nur noch niedrige Büsche wechseln sich ab. Die Berge erstrahlen durch das Gegenlicht der Sonne in den verschiedenen Grautönen etwas unwirklich: die dunkel und geheimnisvoll wirkenden Bergketten im Vordergrund, dahinter reiht sich Gipfel an Gipfel in verschiedenen Abstufungen zum Hellen, bis zu den dunkelweißen Spitzen in der Ferne, den Zweitausendern, die märchenhaft in ihrer Umgebung zu verschwimmen scheinen.
Als die Olivenfelder weniger werden und die Aussicht in die Täler grandioser, nehmen auch die Kräuterdüfte zu. Wir ertappen uns dabei, wie uns bei geöffnetem Fenster ein Hauch von Thymian umweht oder ein Duftstrom von Oregano, auch Gräser und Sträucher, die wir nicht identifizieren können, mit einem Mal die Nase kitzeln. Manchmal halten wir an, rollen zurück zu der Stelle, wo es am intensivsten riecht und versuchen schnuppernd zu erraten, um was für ein Kraut es sich handelt, das da einen so köstlichen Duft verströmt.
Das letzte Dorf vor Omalós heißt Lákki (geschrieben: Λάκκοι, also im Plural) und bedeutet Gruben. Gegraben wird heute nicht, wohl aber an der neu geteerten Straßendecke am Ortseingang gewerkelt. Angenehm windig ist es, als wir im Zentrum, neben der Kirche, parken.
Ein dort seit 2001 existierendes Widerstandsdenkmal mit drei übereinander stehenden Figuren wird einer kleinen Reisegruppe gerade von ihrem Fremdenführer erklärt. Das Denkmal erzählt von der unerschütterlichen Entschlossenheit der Bewohner von Lákki und der Umgebung Sélino im Kampf gegen die Besatzungsmächte, insbesondere gegen die Osmanen, auch oder vielleicht gerade, weil die dargestellten Männer eine Vráka, die traditionelle Pluderhose, tragen. Auch wenn man heute so gut wie niemanden mehr in der alten Tracht sieht (allerdings noch vor dreißig Jahren, zumindest in den Dörfern, fast alle älteren Männer), könnte sie in Verbindung mit diesem Denkmal auch als Symbol der Besinnung auf die traditionellen Werte verstanden werden, der Freiheitsliebe der Kreter, ihre Unbeugsamkeit über die Jahrhunderte hinweg und daraus entstanden die starke Motivation für ihren Widerstand gegenüber jedweden Eroberern.

Die drei Männer, die sich gegenseitig nach oben hin stützen, könnten die Kämpfer aus Lákki, Sélino und Sfakiá in den Aufständen gegen die Osmanische Besatzung symbolisieren, in der auf einer der Inschriften, die am Sockel ringsum angebracht sind, Bezug genommen wird, dem Auszug aus der Kretischen Hymne mit den Versen von Giórgos Paráschos:
 |
Von hier Selinioten und Lakkioten im Feuer, von dort im Feuer die Sfakioten. Überall soll eine Stimme zu hören sein bei unseren ersten Schwerthieben. |
Von der umzäunten Plattform des Denkmals kann man einen Teil des Dorfes, die benachbarten Hügelspitzen und grünen Täler überblicken.



Mittlerweile hat sich die Reisegruppe eines der Lokale auf der Platía ausgesucht. Wir nehmen in dem Kafenío auf der gegenüberliegenden Seite Platz, wo ein paar einheimische Männer Karten zocken und Kaffee trinken. Leise tönt kretische Musik aus dem Radio. Uns dürstet ebenfalls nach einem kräftigen Kaffee, einem Frappé, der sich beim Servieren als Ellinikó entpuppt, lecker und ausreichend. Und erst die dünne Pita mit Honig und ganz wenig Feta (bekannt als Sfakiotische Pita) – ein himmlischer Vormittagssnack.
Im Dorf ist es um diese Zeit recht ruhig. Einmal war ich hier, ein paar Stunden früher am Morgen, als es zuging wie auf der Autobahn. Ein Bus nach dem anderen raste um die Kurve, hinauf nach Omalós, um die begierigen Wanderer schnellst möglich zum Eingang der Samariá-Schlucht zu bringen. Heute fahren nur wenige Busse nach Ablieferung ihrer Personenfracht gemütlich zurück nach Chaniá. Sicherlich liegt das zum einen an der heißen Jahreszeit, in der sich so mancher vor der langen Wanderung scheut, andererseits an der schon fortgeschrittenen Stunde.
Die Wanderung durch die Schlucht hat jedoch keinesfalls ihre Reize verloren und gehört, ganz im Gegenteil, mit zu den beliebtesten Unternehmungen von wanderfreudigen Urlaubern. Und so wird man im Frühjahr und Herbst zu früher Morgenstunden weiterhin bei einem Kaffee in Lákki in der Kurve sitzen und sich ob des vorbeirauschenden Verkehrs, der so gar nicht hierher passt, in einem Parallel-Universum wähnen.
Lákki werden wir heute über die Platía hinaus nicht weiter erkunden. Die Atmosphäre ist zurückhaltend freundlich, ansonsten bleibt man wohl eher unter sich. Auf 450 Meter Höhe gelegen, kommen hier weniger Fremde hin als in die Dörfer an der Küste; für an- und abreisende Wanderer ist das 300-Seelen-Dorf eher ein Durchgangsort, für kurz Verweilende, so wie wir, ein einfach zu erreichendes, nettes Ausflugsziel mit einer schönen Aussicht in die Bergwelt.
Bei unserer Weiterfahrt entdecken wir noch Reste der alten Straße, mit ihren engen und steilen Kurven. Heute dagegen gleitet man über eine breite, mit Parkbuchten und Leitplanken, gesicherte Strecke dahin.



Stellenweise sind beide Seiten mit dünnen Oleandersträuchern bepflanzt. Später einmal wird sich ein rosa-weißes Band nach Omalós schlängeln.
Die Vegetation wechselt jetzt merklich. Olivenbäume kommen seltener vor, die Hügel rundherum sind vorwiegend mit niedrigen Büschen bewachsen.

Unterwegs fallen uns Hinweistafeln auf zwei Denkmäler auf. Das eine bezieht sich auf den Stützpunkt des lakkiotischen Helden Sarridantónis, einem Filikós (Mitglied des Geheimbundes Filikí Etería) und Anführer von tausend Kämpfern (1821).


Das andere weist auf den Todesort zweier Widerstandskämpfer gegen die deutsche Besatzung hin: Andréas Vándoulas und der Neuseeländer Dudley Perkins, genannt Vassilis, geehrt mit dem Titel „Löwe von Kreta", die am 28.02.1944 den Tod fanden. Bei der Enthüllung des Denkmals im Jahr 1971 waren neben politischen und kirchlichen Würdenträgern vierzig neuseeländische Veteranen der Schlacht um Kreta zugegen, und Patrick L. Fermor, jener britische Offizier, der am 26. April 1944 maßgeblich an der Entführung des kommandierenden deutschen Generals Heinrich Kreipe auf Kreta beteiligt war.

Kurz vor dem Eingang nach Omalós sind die Hügel mit Bäumen bestanden, vielleicht die Reste eines ehemaligen Waldes. Im Kapitel „Der letzte Wald“ des 1988 erschienen Buches „Blumen von Kreta“ resümiert der Autor Yanoúkos Iatrídis, dass schon seit der Antike Raubbau an den kretischen Wäldern betrieben wurde und als Ergebnis der „länger als 8000 Jahre anhaltenden menschlichen Exzesse“ der kretische Wald heute fast ganz verschwunden ist. Reste gäbe es nur noch in Form von kleinen Flecken.
Zwischen den licht bewaldeten Hügeln führt die Straße wieder leicht bergab, und nach wenigen Kurven liegt die Ebene von Omalós vor uns.


Die erste Häuseransammlung, die fast ausschließlich aus wenigen Unterkünften und Restaurants besteht, lassen wir ohne anzuhalten hinter uns und durchqueren die Ebene auf einer schmalen Straße, denn Alex ist gespannt wie ein Flitzebogen auf die Abbruchkante der Xylóskalo, über die man mehrere hundert Meter in die Samariá-Schlucht hinabsteigt.





Wahrzeichen des Schluchteneingangs ist eine Italienische Zypresse (Cupressus Sempervirens) in einer Horizontalform, anders als die hoch aufragende, schlanke Art, die in der Regel bei Kirchen, Kapellen und Friedhöfen stehen. Dieser einzelne Baum könnte schon sehr alt sein.
Weiter philosophiert der Autor im oben genannten Buch, dass die Omalós-Ebene vor ihrer menschlichen Nutzung einst mit einem Zypressenwald bedeckt gewesen sein könnte. Wenn man sich vorstellt, wie geheimnisvoll die Gegend gewirkt haben muss, begleitet von den Geräuschen des Windes in den Ästen der knorrigen Bäume; wilde Tiere, die den Wald bewohnten; Dämonen, die aus den Tiefen der Tzánis-Höhle, am Eingang zur Ebene hervorkrochen, und ihren Tribut forderten - eine Landschaft, wie geschaffen für die Entstehung von Mythen und Sagen.

Landschaft - ein Begriff, dessen Ausführung nach dem Verständnis dieser Region, insbesondere der Samariá-Schlucht, an ihrem Eingang auf einem schon etwas in die Jahre gekommenen Plakat zu finden ist.
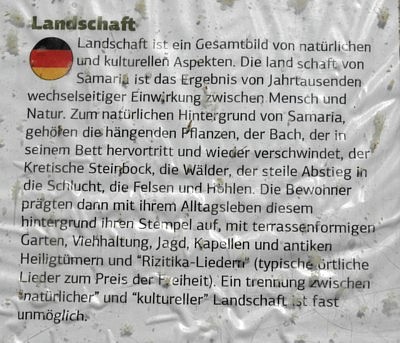
Schräg hinter dieser Tafel blüht ein riesiger Thymian-Strauch in seiner allerschönsten Pracht.

Um Alex den Mund so richtig wässrig auf eine Wanderung zu machen, fahren wir die letzte Steigung hoch zum Lokal „Xylóskalo“. Leider müssen wir feststellen, dass das am Fuße des Gíngilos gelegene Café mit seiner fantastischen Aussicht vom Balkon bis tief in den Schluchtengrund leider geschlossen hat. Hoffentlich nur temporär.

Zu einer anderen Jahreszeit (keinesfalls im Hochsommer!) werden wir wieder hierherkommen und die Schlucht gemeinsam durchwandern. Ich schwärme von den Düften des Waldes und den Maserungen des Sandsteins, den engen Stellen, an denen sich die hohen Wände fast berühren, dem klaren Gebirgswasser, dem Dorf Samariá und der Stille dort, wo der Bach unterirdisch weiterfließt und die Welt plötzlich zu verstummen scheint, wenn nicht der Mensch durch sein Getöse stört.
Auf dem Rückweg möchten wir die Omalós-Ebene einmal umrunden. Die einst schmalen Schotterwege sind heute asphaltiert. Früher konnte man kreuz und quer über die Felder laufen, heute sind die Grundstücke fast alle eingezäunt. Schafe sehen wir keine mehr. Bei meinen vorherigen Besuchen grasten mehrere Herden wild (und ohne Hütehunde!) auf den Grasflächen.
Die Ebene wird auch heute noch landwirtschaftlich genutzt; sie ist insbesondere mit Obstbäumen bepflanzt. Weizen wird jedoch nach unserem Ermessen nicht mehr angebaut. Vor Jahrzehnten war Omalós mit seinem fruchtbaren Boden bekannt für den Getreideanbau, wie Fotos aus jener Zeit belegen. Mit einfachsten mechanischen Mitteln und sehr viel menschlicher Arbeitskraft wurde gesät, gejätet, geerntet und gedroschen.
Mitten in der Ebene, bei den Dolinen und Senken, in denen sich im Frühjahr das Schmelzwasser zu kleinen Seen sammelt, wird großflächig Erde bewegt. Vielleicht entsteht ein Speicher für das Schmelzwasser des Frühjahrs, der die benötigte Bewässerungsmenge für den Sommer festhält? Eventuell werden auch die Dolinen verfüllt. Oder man möchte vielleicht weitere Unterkünfte für die Schluchtenwanderer bauen. Auf jeden Fall ist die Staubfahne der Baustelle schon von weitem sichtbar. Am Abzweig nach Soúghia weist ein Riesenschild die Richtung. Von der Größe des Wegweisers könnte man auf eine breite Schnellstraße schließen, dabei geht es tatsächlich nur 1000 Meter über unzählige Serpentinen bergab.
In der Nähe des Abzweigs standen die Hütten von Bauern oder Hirten, kleine Kuben aus Naturstein, die jetzt zu Unterkünften für Touristen umgebaut und modern hergerichtet sind. Und so finden wir auch die Hütte von Pávlos nicht mehr, der uns in seinem rustikalen Hof einst einen wundervollen Salat mit zwei riesigen, dicken, köstlichen Feta-Scheiben aufgetischt hatte. Nur das vor vielen Jahren in der Mitte zusammengekrachte Haus erkennen wir wieder, es rottet weiter vor sich.
Im Hotel „Néos Omalós“ kehren wir ein, wo ich schon mehrmals in Gesellschaft oder alleinreisend übernachtet und mich jedes Mal sehr wohl gefühlt habe. Der holzvertäfelte Innenraum der Taverne sieht aus wie eh und je, nur der Fernseher ist eine Nummer größer geworden. Einige alte Fotos von Omalós zieren die Wände, sodass man einen Eindruck vom früheren Leben erhält. Eines davon zeigt Arbeiter im Jahr 1954, als sie die erste Straße von Lákki nach Omalós bauten.
Der süße Raumerfrischungsduft an der Rezeption ist noch in meiner Erinnerung erhalten. Aus der Küche hört man Gewerkel, Vorbereitung auf den abendlichen Tavernen-Ansturm. Im Außenbereich setzen wir uns an einen der wenigen Tische in der gemütlichen, schattigen Pergola.


Es tut gut, an Orte zu kommen, auch nach so langer Zeit, an denen sich eher wenig oder auch nichts verändert hat, an denen man sich auf Altbewährtes beruft und daran festhält. Fortschrittsfetischisten, die Stillstand mit Rückschritt gleichsetzen, würden hier verzweifeln. Für mich ist es ein wunderbares Erlebnis, die Dinge so vorzufinden, wie sie immer waren. Ein Familienbetrieb, in dem zwar hart, professionell und erfolgreich gearbeitet wird, bei dem das Menschliche aber auch sichtbar wird, als ich erstaunt feststelle, dass Giórgos, der Wirt, sich nach all den Jahren tatsächlich lächelnd an mich erinnert und sich nach meinen damaligen Mitreisenden erkundigt.
Nach dem frischen Salat mit leckeren, festen Tomaten und obercremigstem Myzíthra, möchten wir das Giannáris-Denkmal besichtigen, das nur wenige Gehminuten entfernt, auf einer kleinen Anhöhe, steht.

Chatzí-Michális Giannáris, 1831 in Lákki geboren, 1916 in Máleme bei Chaniá gestorben, stammte aus einer Priesterfamilie. Zusammen mit seinem Vater und den Brüdern unternahm er eine Pilgerreise ins Gelobte Land - daher auch sein Beiname Χατζή (Chatzí). Auch in der jüdischen und islamischen Kultur gibt es diesen Ehrentitel. Jeder, der sich auf einen Hadsch begeben hat, also je nach Glaubensrichtung zu seinem heiligsten Ort (Jerusalem bzw. Mekka) gepilgert ist, darf anschließend den Ehrentitel Hadschi im Namen tragen.
Giannáris war einer der großen kretischer Anführer im Freiheitskampf gegen die Osmanische Besatzung, dessen Name insbesondere mit dem kretischen Aufstand von 1866 verknüpft ist. Obwohl er mehrfach verfolgt und gefangen genommen wurde, gelang es ihm jedes Mal zu entkommen. Bei einer dieser Inhaftierungen schworen sich siebzehn seiner lakkiotischen Mitstreiter, dass sie – falls er aus dem Gefängnis gerettet würde – ihm zu Ehren eine Kirche errichten würden. Dieser Schwur hängt in Stein gemeißelt über dem Eingang der verschlossenen Kapelle auf dem Gelände des Denkmals und trägt das Datum vom 16. Februar 1862.


Giannáris überlebte nicht nur diesen Aufstand, sondern auch das Ende der Osmanischen Herrschaft. Ab dem 9. Dezember 1898 war Kreta befreit, am 30. Mai 1913 erfolgte der Anschluss an Griechenland.
Eine weitere Tafel, mit seinem Vermächtnis, wurde in Stein graviert über dem Eingang des einstigen Wohnhauses angebracht:
 |
Dieses Haus und dessen Nebengebäude, gewidmet meinem Schutzpatron Agios Panteleimon. Nach meinem Tod übergeht alles gemäß meinem selbst verfassten Testament an die neben stehende Kirche unter der Verwaltung meiner Geburtsgemeinde Lakki. 1901. |

Ein ganz niedriges Gebäude mit einer offenen, sehr niedrigen Tür beherbergt schließlich das schmucklose Grab. Kretische Schulklassen unternehmen gelegentlich Ausflüge hierher, um über die Geschichte zu lernen. Vielleicht gibt es im Inneren des Hauses noch mehr zu sehen, Fotos oder schriftliche Zeugnisse, doch zum einen sind alle Türen, bis auf die Grabkammer, verschlossen, zum andern ist niemand da, den man fragen könnte. So geben wir uns zufrieden in der Gewissheit, zu Hause im Internet weiter recherchieren zu können. Hat man jedoch einmal die Orte aufgesucht, die mit der kretischen Geschichte verknüpft sind, so gewinnen die Worte aus dem Lexikon eine größere Bedeutung, da man sich die damit verbundenen Vorkommnisse besser vorstellen kann.
Nach der Besichtigung fahren wir wieder zurück und biegen, statt nach Lákki zu fahren, ab in Richtung Káranos. Die schmale Landstraße führt durch eine Landschaft, die zusehends wieder satter wird; Olivenfelder, Feigen-, Nuss- und andere Nutzbäume stehen in der Nähe der wenigen, kleinen Weiler.








Skinés liegt inmitten von Apfelsinenplantagen. Viele der Bäume hängen immer noch voller saftiger Früchte. Sind diese in ihrer Masse möglicherweise für sonnengereiften Saft vorgesehen?


Eine nette Frau in einem Café, mitten im Dorf, fragt, wo ich herkomme. Nach Beantwortung der Frage legt sie mir sogleich einige Früchte auf den Tisch. Sie sehen äußerlich nicht wie die gelackten Orangen aus dem Supermarkt aus, haben dunkle Flecken oder Verwerfungen in der Schale, doch schon beim Schälen läuft der Saft über Hände und Arme, süß und saftig. So sollen Apfelsinen schmecken!
Im Ort laufen derzeit die Vorbereitungen für das Orangenfest am 30.Juli, zum Abschluss der Orangensaison, wie ein über die Straße gespanntes Transparent ankündigt. Mitten im Dorf wurde dazu eine Riesenapfelsine aufgebaut. Früchte dafür scheint es tatsächlich im Überfluss zu geben. Zum Fest wird kretische Musik erwartet. Γιώργος Σκευάκης (Giórgos Skevákis) und Μανώλης Αγγελάκης (Manólis Angelákis) werden ab 21 Uhr aufspielen. Vielleicht fahren wir hin.


Während wir unsere Soda trinken, fällt mir auf, dass wir hier nicht die mit dem blauen Label bekommen, die mit Medium-Kohlensäure, sondern die alte Tuborg, allerdings in modernem Flaschendesign. Alte Kretafahrer erinnern sich an das Gebräu, das damals so ganz anders schmeckte als das im deutschen Handel erhältliche Mineralwasser. Ein Unmaß an Kohlensäure war in die schmalen Flaschen hineingepumpt, sodass einem beim Öffnen nicht selten der Kronkorken um die Ohren flog und man auf sein Augenlicht achtgeben musste.
Ja, doch, ich halte es für erwähnenswert, weil es Teil der Erinnerung ist, weil ich jahrelang mit dem Rülpswasser gekämpft habe, und ich feststelle, dass heute alles geschmeidiger geworden ist, angepasster, dank EU-Normen, mit ihren Vor- und Nachteilen. Und so sinniere ich über dem Flaschenwasser in Skinés mit dem roten Einband, das heutzutage aber genauso wie das mit dem blauen ziemlich medium schmeckt.
